Lesezeit: ca. 15 MinutenArt Democracy"Halbvoll ist das neue Ausverkauft.", ulkte die Moderatorin Barbara Schöneberger schon vor rund einem Jahr beim Blick auf ihr Theaterpublikum. Und sie sollte recht behalten.
Auch jetzt, zahlreiche Monate nach den letzten Lockdowns, besuchen viel weniger Menschen klassische Konzerte, Theater- und Opernaufführungen als vor Beginn der Pandemie.
Das Drama in Zahlen: Der Oper Frankfurt beispielsweise sind etwa 5000 von 12000 Abonnenten abgesprungen. Die Wiener Burg hatte vor Corona 83% Auslastung, heute nur noch 68%. Anderen Theatern sind sogar lediglich 25% ihres Publikums geblieben. Die Rede ist von einem pandemischen Besucherschwund.
Auch in der Kulturbranche hat Corona seine berühmt-berüchtigte Brennglaswirkung entfaltet, und eine Entwicklung, die schon früher begonnen hatte, beschleunigt. Die zuvor kontinuierlich schrumpfenden Besucherzahlen stürzen nun ins Bodenlose. Junge Menschen, die in Theater- und Opernhäusern sowieso die Minderheit gebildet haben, lassen sich fast gar nicht mehr blicken und die älteren immer weniger. Aus Angst vor einer Corona-Ansteckung? Wohl kaum. Die überfüllten Züge in der Zeit des Neun-Euro-Tickets letzten Sommer sprechen dagegen.
Was also ist es dann?
„Die Menschen hören abends inzwischen lieber ein Hörbuch auf dem Sofa oder schauen einen Film auf Netflix“findet zum Beispiel Klaus Biesenbach, Direktor der Neuen Nationalgalerie. Und Armin Petras, früher Intendant in Stuttgart, heute in Cottbus, fordert: „Wir müssen wieder Anlässe schaffen, damit die Menschen ins Theater gehen wollen.“ Es haben sich neue Gewohnheiten etabliert und die gilt es erst einmal zu brechen: „Wir müssen unser Publikum wieder aus dem Hamsterbau herausholen.“
Für Birgit Mandel, Professorin für Kunstvermittlung an der Universität Hildesheim und Expertin für das Thema Audience Development, ist das Problem struktureller Natur:„Deutschland verfügt über rund 140 öffentliche und noch mehr Privattheater sowie 130 Opern-, Sinfonie- und Kammerorchester, dazu noch 80 Festspiele“, erklärt sie, „jeden Abend wird etwas anderes gespielt und jeden Abend sollen die Häuser voll sein!“ Das hätte in den Zeiten, als die Bühnen noch das Monopol auf Unterhaltung und Bildung hatten, funktioniert. Doch heute stehen die Theater zwar noch in der Mitte der Städte, aber nicht mehr in der Mitte des Interesses.
„Theater ist in Deutschland schon immer eine bildungsbürgerliche Angelegenheit gewesen“, sagt Mandel, dafür sorgen schon die Kartenpreise. Ein launiger Theaterabend kostet heutzutage in der Regel mehr als ein Netflix-Monatsabo. Ein Umstand, auf den die Organisatoren des Kulturbetriebs bereits reagieren: mit sogenannten U 30-Flatrates, Buddy-Tickets – und Kultur-Staatsministerin Claudia Roth wünscht sich zudem Gutscheine für junge Menschen nach Vorbild des französischen „Pass Culture“.
Doch günstiger Eintritt allein wird es nicht richten.
„Das, was in den Theatern passiert, muss relevant werden“, sagt Mandel. Goethes Faust und sein Frauenbild interessiere in Zeiten von Emanzipation und Diversität nicht mehr. „Wir brauchen neue Stücke, neue Themen, neue Formate“, sagt Mandel. Das wissen die Theatermacher längst, viele haben ihre Spielpläne bereits verändert – mit mäßigem Erfolg.
Schillernde Ausnahme ist die Berliner Schaubühne. Warum sie trotz der Krise weiterhin eine Auslastung von mehr als 90 Prozent erzielt? Erstens weil die Hauptstadt ebenfalls eine Ausnahme darstellt: „Nach Berlin ziehen die Menschen unter anderem wegen des Theaterangebots“, erklärt Petras. Und zweitens, weil es der Schaubühne gelingt, Stars zu Zugpferden zu machen – fast die Hälfte des Ensembles kennt man aus dem „Tatort“.
Doch auch jenseits von Berlin gibt es Erfolgsgeschichten.
Es lohnt sich vor allem der Blick ins Ausland, meint Mandel, und verweist nach England. Dort sind die Subventionen für Theater nicht nur an die Bedingung geknüpft sind, dass die Häuser gut besucht sind, sondern auch daran, dass das Publikum einen Querschnitt des jeweiligen Stadtviertels abbildet.
Wozu das führt? „Im Contact Theatre in Manchester bestimmen seit einigen Jahren Jugendliche das Programm ganz erheblich mit“, erklärt Mandel.
Ein anderes Vorbild ist das Theater Basel. Dessen Foyer steht auch tagsüber offen, wodurch das Haus zu viel mehr als einem reinen Aufführungsort geworden ist, nämlich auch zu Café und Treffpunkt. Oder wie Mandel es ausdrückt, zu einem „Community-Builder“. Ideen solcher Art gibt es viele. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man die Logen der Theater mit bequemeren Sitzgelegenheiten ausstattet? Nicht ohne Grund sind die komfortablen Zweiersessel in den Astor-Kinos in Deutschland regelmäßig ausgebucht, übrigens die einzigen Filmtheater, die laut Veranstalter nach Corona ähnlich hohe Besucherzahlen verzeichnen wie vorher.
Und warum drängeln sich die Kulturinteressierten nach der Aufführung ungeduldig an der Garderobe, anstatt an einer attraktiven Theaterbar bei einem Glas Wein noch ein Stündchen über das Stück zu plaudern?
Das gastronomische Konzept der Spielstätten für die Pause hat ebenfalls Luft nach oben: Isst sich eine vegetarische Bowl im Stehen womöglich unkomplizierter als das obligatorische Lachsschnittchen mit Salat und Sahnemeerrettich?Und warum sind die Brezeln im Theater meist noch altbackener als das Programm?
Und dann die Programmhefte. Mit ihren komplizierten Texten scheinen sie sich oftmals an ein Fachklientel zu wenden“,sagt Mandel. Womit ein weiterer wichtiger Punkt angesprochen ist: die Kunstvermittlung. Denn nicht nur Programmhefte, sondern auch die postalisch verschickten, zusammengefalteten Monatsspielpläne treffen nicht mehr den Nerv der Zeit: „Meine 16-jährige Tochter hat mir klargemacht, dass ich, wenn ich sie erreichen möchte, auch die Kanäle nutzen muss, unter denen sie zu erreichen ist“, sagt Petras.
Das hat auch Jochen Sandig erkannt: Der Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele sagt im Interview: „Heute reicht es nicht aus, nur in den Tageszeitungen oder Stadtzeitschriften zu inserieren. Man muss sehr stark die sozialen Medien bedienen, und dafür braucht es viel Kreativität und einen langen Atem.
Denn erst muss das gewünschte Zielpublikum einem ja folgen, die Website besuchen und den Newsletter abonnieren. Wir bemühen uns um eine wachsende Community, die aktiv ist und Inhalte teilt.“
Und ja, die älteren Besucher seien manchmal irritiert, dass es jetzt weniger umfangreiche gedruckte Programmhefte und mehr auf die digitale Plattform verlinkende QR-Codes gibt, aber: „Ich habe das Gefühl, dass sich auch dieser Teil des Publikums an die digitale Informationsübermittlung und das Online-Ticketing gewöhnt hat.
Die Pandemie hat diesen Prozess katalysiert. Wir hatten ja keine Wahl, wir mussten das Publikum erreichen, wir wollten unbedingt auf Sendung bleiben, und das ging ja monatelang nur digital oder hybrid.“
Während der Pandemie hat Sandig für seine Schlossfestspiele unter anderem mit Hilfe von MHP und Porsche eine sogenannte Digitale Bühne ins Leben gerufen: Öffnet man die Website, sieht man in einen bunt beleuchteten Theaterraum. Startet die jeweilige Aufnahme, bewegt sich der Kronleuchter zur Decke und es wird dunkel. Ein Moment, der, wie Sandig findet, im analogen Leben etwas Magisches hat: „Wenn das Publikum plötzlich still wird, kurz bevor die Aufführung beginnt.“
Die Inszenierungen wurden aber nicht nur auf den Computern zu Hause gestreamt, sondern auch auf einer großen Leinwand im Schlosshof übertragen, wo das Publikum die Aufführungen kostenlos verfolgte – und begeistert war.
„Je belebter der Ort der Übertragung, desto stärker die magnetische Wirkung“, erklärt Sandig. Auch, weil man ein Zufallspublikum erreicht, Menschen, die eigentlich nur Pizza essen gehen wollten, sich dann aber noch mit einem Aperol-Spritz auf die Stufen der Kirche setzen und der Musik lauschen. Frei nach dem Motto: Kommt der Prophet nicht zum Berg, muss der Berg zum Propheten kommen. Außerdem ist so ein Public Viewing eben auch ein Live-Erlebnis, etwas Gemeinschaftliches.
Für das Streamen am privaten Rechner gilt: „Heute, nach den Lockdowns, stellen wir unsere Aufnahmen lieber zeitversetzt zur Premiere online, in der Hoffnung, dass die Menschen das Konzert zum ersten Mal lieber live erleben und dann die Möglichkeit nutzen, es noch einmal nachzuhören und die Begeisterung für die Inhalte zu teilen,“ so Sandig.
Die Digitalisierung hat längst gezeigt, wie unverzichtbar sie für den Kulturbetrieb geworden ist. Sowohl in der Vermittlung als auch in den Inszenierungen selbstGroßartig gefällt zum Beispiel Detlev Baur, Chefredakteur des Theatermagazins „Die Deutsche Bühne“, das Kollektiv „punktlive“. Das erfand mit seinen Inszenierungen „werther.live“ und „möwe.live“ ein Theater am Desktop. Die Schauspieler probten online, die Aufführungen wurden live gestreamt und Goethes und Tschechows Klassiker völlig neu erzählt: Der Zuschauer sieht, wie die Figuren chatten und Sprachnachrichten versenden, sich durch Instagram - und Facebook-Feeds scrollen oder im Zoom-Call miteinander flirten. Für die Interpretation von Goethes Briefroman „Werther“ gab es sogar den Deutschen Multimedia-Preis 2020. Und Ende September führte das Kollektiv am Staatstheater Nürnberg sein drittes Stück auf: „odysseus.live“ – als Talkshow inszeniert, die man sowohl im Theater als auch online verfolgen konnte.
Also: Will man neues Publikum gewinnen, muss man neue Wege gehen. Und viele Theater haben sich aufgemacht. Das Augsburger Staatstheater verschickt VR-Brillen an seine Kundschaft. In Bremen steht ein Stück auf dem Programm, das von einer KI geschrieben wurde. Und während des Bachfests in Leipzig vor zwei Jahren sang ein Teil des Chors zwar in der Thomaskirche, andere Sänger intonierten das Werk aber zu Hause, zeichneten sich dabei auf und später wurde alles zu einem Gesamtkunstwerk zusammengesetzt.
Auch im Ausstellungsbereich eröffnet die Digitalisierung neue Chancen. Gerade tourt die Schau „Monets Garden“ durch Deutschland, in der die Gemälde von Claude Monet als 360-Grad-Videos in die Räume projiziert werden. Blütenblätter schweben durch die Luft, Flüsse plätschern an einem vorbei, die Bilder werden lebendig, man kann sie betreten und ganz in sie eintauschen. Die Luft duftet nach Lavendel, Musik von Monets Zeitgenossen erklingt. Ein immersives Erlebnis, das in den impressionistischen, vor Farbe flimmernden Gemälden bereits durch die riesigen Formate angelegt sei, sagt Nepomuk Schessl, Produzent der Ausstellung. Er glaubt sogar: „Hätte Monet die heutigen Möglichkeiten gehabt, hätte er es wahrscheinlich ähnlich gemacht wie wir.“
Erfüllte Seelen in gefüllten SälenIn diesem Sinne wünscht sich auch Brigit Mandel „eindringliche Inszenierungen, die zugleich künstlerisches Ereignis sind wie auch Gemeinschaft erlebbar machen.“ Und Sandig: „erfüllte Seelen in gefüllten Sälen.“ Dabei geht es den beiden keinesfalls um die Eventisierung von Kunst, sondern um ein intensiveres Erleben. Etwas, woran Sandig schon seit Jahrzehnten arbeitet. Zum Beispiel, indem er Kunst, Tanz und Musik aus althergebrachten Räumen und Zusammenhängen befreit.
So verwandelte er Anfang der 90er-Jahre unter anderem eine Kaufhauspassage in der Berliner Friedrichstraße in das legendäre Kunsthaus Tacheles, transformierte ein historisches Pumpwerk am Spreeufer in das Veranstaltungszentrum Radialsystem und führte in Bordeaux Brahms Requiem als „Requiem Human“ in einem ehemaligen deutschen U-Boot-Bunker auf.
„Solche Rauminszenierungen verändern sehr die persönliche Wahrnehmung“, sagt er. Es gibt kein Vorne und Hinten mehr, keine Frontalbespielung, sondern ein Miteinander. Um das zu erreichen, platziert er Musiker und Sänger auch gerne mal zwischen den Besuchern: „Zuerst kann man den Klang der Instrumente und Stimmen nicht zuordnen, dann merkt man plötzlich, die Akteure sind ganz nah und man selbst ist mittendrin.“
Das Überschreiten althergebrachter Grenzen ist auch für den Chef der Neuen Nationalgalerie Biesenbach selbstverständlich: „Eigentlich müssen wir das lange Jahr der Museen haben und die Logik der langen Nacht als Normalzustand ausrufen.“
Denn: „Das Gemeinsame und das Pro-Aktive sind für mich der utopische Auftrag der Moderne und der Kunst.“
In Cottbus führt Petras gerade die „Two Penny Opera“ auf – eine Überschreibung von Brechts „Dreigroschenoper“.
„Auf diese Schallplatte der Londoner Band ,The Tiger Lillies‘ sind wir per Zufall gestoßen und ich dachte, das wäre doch vielleicht etwas für die ganze Familie!“, erklärt Petras. Das Ergebnis ist eine Art Rock-Zirkus mit großer Überraschung zum Finale: Draußen vor dem Theater wartet ein Zirkuswagen auf die Besucher, wo die Show nach der Aufführung weitergeht.
Klingt wie ein Versprechen für die Zukunft.
Mehr entdecken:
Im Zeitalter des Homo Digitalis
Wie die Digitalisierung unser Leben, Denken und Sein verändern wird.
Goodbye Routine, Willkommen Krisenmodus!
Wieso Überraschungen den Fortschritt beschleunigen. Weshalb Notsituationen kein Grund zur Panik sind. Warum Krisen nicht automatisch zu Katastrophen führen. Wie aus "New Normal" ein "Better Normal" wird.
Text: Verena Richter
Verena Richter hat Theaterwissenschaft studiert und sich im Laufe ihrer journalistischen Laufbahn zudem auf Kunst, Architektur und Design spezialisiert.












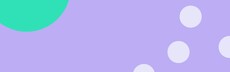




































 Art Democracy
Art Democracy
 „Die Menschen hören abends inzwischen lieber ein Hörbuch auf dem Sofa oder schauen einen Film auf Netflix“
„Die Menschen hören abends inzwischen lieber ein Hörbuch auf dem Sofa oder schauen einen Film auf Netflix“
 „Das, was in den Theatern passiert, muss relevant werden“, sagt Mandel. Goethes Faust und sein Frauenbild interessiere in Zeiten von Emanzipation und Diversität nicht mehr. „Wir brauchen neue Stücke, neue Themen, neue Formate“, sagt Mandel. Das wissen die Theatermacher längst, viele haben ihre Spielpläne bereits verändert – mit mäßigem Erfolg.
„Das, was in den Theatern passiert, muss relevant werden“, sagt Mandel. Goethes Faust und sein Frauenbild interessiere in Zeiten von Emanzipation und Diversität nicht mehr. „Wir brauchen neue Stücke, neue Themen, neue Formate“, sagt Mandel. Das wissen die Theatermacher längst, viele haben ihre Spielpläne bereits verändert – mit mäßigem Erfolg.
 Es lohnt sich vor allem der Blick ins Ausland, meint Mandel, und verweist nach England. Dort sind die Subventionen für Theater nicht nur an die Bedingung geknüpft sind, dass die Häuser gut besucht sind, sondern auch daran, dass das Publikum einen Querschnitt des jeweiligen Stadtviertels abbildet.
Es lohnt sich vor allem der Blick ins Ausland, meint Mandel, und verweist nach England. Dort sind die Subventionen für Theater nicht nur an die Bedingung geknüpft sind, dass die Häuser gut besucht sind, sondern auch daran, dass das Publikum einen Querschnitt des jeweiligen Stadtviertels abbildet.
 Isst sich eine vegetarische Bowl im Stehen womöglich unkomplizierter als das obligatorische Lachsschnittchen mit Salat und Sahnemeerrettich?
Isst sich eine vegetarische Bowl im Stehen womöglich unkomplizierter als das obligatorische Lachsschnittchen mit Salat und Sahnemeerrettich?
 Während der Pandemie hat Sandig für seine Schlossfestspiele unter anderem mit Hilfe von MHP und Porsche eine sogenannte Digitale Bühne ins Leben gerufen: Öffnet man die Website, sieht man in einen bunt beleuchteten Theaterraum. Startet die jeweilige Aufnahme, bewegt sich der Kronleuchter zur Decke und es wird dunkel.
Während der Pandemie hat Sandig für seine Schlossfestspiele unter anderem mit Hilfe von MHP und Porsche eine sogenannte Digitale Bühne ins Leben gerufen: Öffnet man die Website, sieht man in einen bunt beleuchteten Theaterraum. Startet die jeweilige Aufnahme, bewegt sich der Kronleuchter zur Decke und es wird dunkel.
 Die Digitalisierung hat längst gezeigt, wie unverzichtbar sie für den Kulturbetrieb geworden ist. Sowohl in der Vermittlung als auch in den Inszenierungen selbst
Die Digitalisierung hat längst gezeigt, wie unverzichtbar sie für den Kulturbetrieb geworden ist. Sowohl in der Vermittlung als auch in den Inszenierungen selbst
 So verwandelte er Anfang der 90er-Jahre unter anderem eine Kaufhauspassage in der Berliner Friedrichstraße in das legendäre Kunsthaus Tacheles, transformierte ein historisches Pumpwerk am Spreeufer in das Veranstaltungszentrum Radialsystem und führte in Bordeaux Brahms Requiem als „Requiem Human“ in einem ehemaligen deutschen U-Boot-Bunker auf.
So verwandelte er Anfang der 90er-Jahre unter anderem eine Kaufhauspassage in der Berliner Friedrichstraße in das legendäre Kunsthaus Tacheles, transformierte ein historisches Pumpwerk am Spreeufer in das Veranstaltungszentrum Radialsystem und führte in Bordeaux Brahms Requiem als „Requiem Human“ in einem ehemaligen deutschen U-Boot-Bunker auf.
 In Cottbus führt Petras gerade die „Two Penny Opera“ auf – eine Überschreibung von Brechts „Dreigroschenoper“.
In Cottbus führt Petras gerade die „Two Penny Opera“ auf – eine Überschreibung von Brechts „Dreigroschenoper“.
 Mehr entdecken:
Mehr entdecken: